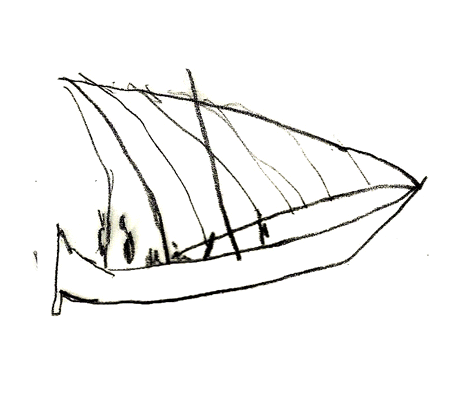• IMO: 100422
• Name: Marine Robin
• Vessel Type: Truppentransporter
• Build: *
• Flag: US
• Home port: Shanghai
• Next port: Bremerhaven
Die Wörter finden die Dinge nicht
von Dagmar Petrick
Schon in meiner Kindheit bestand eine Kluft zwischen den Bewegungen des Mundes, dem, was ich sah, und dem, was ich hörte – mit dem einen Ohr, das mir nach einer Gehirnhautentzündung – ich hatte noch nicht einmal sprechen gelernt – geblieben war.
Dieser ins kaum Merkliche verschobene Widerspruch fließt bis heute in mein Schreiben, das einem unablässigen Bemühen gleicht, die Bruchstellen zu kitten, ob sich nicht wieder jene Übereinstimmung erzeugen lässt zwischen den Wörtern und den Dingen, von der ich annehme, dass es sie einmal gegeben haben muss.
Herta Müller sagte es ähnlich; in ihrem autobiographischen Essay In jeder Sprache sitzen andere Augen schreibt sie: „Was kann das Reden? Wenn der Großteil am Leben nicht mehr stimmt, stürzen auch die Wörter ab. Ich hab die Wörter abstürzen sehen, die ich hatte (…) Dennoch der Wunsch: Es sagen können. Wenn ich den Wunsch nicht ständig gehabt hätte, wäre es nicht so weit gekommen, für die Milchdistel Namen auszuprobieren, um sie mit ihrem richtigen Namen anzureden. Ich hätte ohne diesen Wunsch um mich herum nicht das Fremdeln verursacht als Folge missratener Nähe.“
Ich probiere keine Namen aus. Bei mir ergibt sich die verschwindend geringfügige Verschiebung zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten jedes Mal aufs Neue aus dem Missverstehen des Klangs, ganz von allein. Wenn aus der Frage Was ich beachten muss unversehens Apfelmus wird oder ein Freund, der ein Hemd kaufen will, sich in meinen Ohren ein Handy besorgt, falle ich selbst aus der Welt. Missratene Nähe als Daseinsform; fast könnte man sagen: Das Missverständnis ist meine Lebensmelodie.
Was bleibt? Ein Stift in der Hand und ein Blatt Papier, worauf ich die Wörter und die Dinge nahtlos in Eins zu schieben versuche. Allzu oft gelingt es nicht.
Natürlich gibt es dennoch Geräusche, Klänge, Töne, die nicht der Sprache unterliegen und sich darum auch nicht mit Buchstaben einfangen lassen. Meine Wohnung ist eine Fundgrube. Ich stehe still und höre zu.
Da ist das Schnarchen meines Hundes, der sich auf dem Sofa zusammengerollt hat in seinem eingebildeten Steppengras. Da ist das Knacken in den Leitungen, das durch die Mauern zittert und gelegentlich in ein Seufzen mündet, als holte das alte Haus, das schon so viel gesehen hat, unter dem Ansturm unzähliger Geschichten Luft. Doch darunter mischt sich noch etwas. Es kommt nicht von außen, es kommt aus mir. Ein hoher greller Ton, ein Pfeifen. Es klingt wie der Kühlschrank meiner Oma von einst. Und prompt bin ich wieder da, bei ihr.
Manchmal durfte ich bei Oma übernachten. Ich schlief neben ihr im großen Ehebett, dessen rechte Seite schon seit Jahren leer blieb; ich habe meinen Großvater kaum gekannt. Die Tür zum Flur stand offen. Aus der Küche kam ein Zischen. Es zog durch den Flur ins Schlafzimmer bis an mein Ohr. Ein hoher greller Ton wie das Schleifen eines Fingernagels über eine Garagenwand. Es hielt mich wach und machte mir Angst, denn ich wusste nicht, was es war, ich wagte aber nicht, meine Oma zu wecken.

Erst am anderen Morgen beim Frühstück erklärte sie es mir. Oma schüttete mir Milch in den Becher.
Der Krieg hatte sie nach China verschlagen. 1940 kam sie von Niederländisch Indien, heute Indonesien, nach Shanghai. Am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium noch von der Schulbank weg heiratete mein Großvater, der ihr Mathematiklehrer war, das hübsche bezopfte Mädchen mit den rosigen Wangen.
Sie habe die Grippe gehabt, erzählt sie mir. Da sei er mit Blumen im Krankenhaus aufgetaucht und habe um ihre Hand angehalten, einfach so, und ja, da habe sie halt Ja gesagt, und dann ging das natürlich nicht mehr mit dem Abitur.
„Warum ging das denn nicht mehr, Oma?“, frage ich.
„Frag nicht“, sagt sie. „Trink deine Milch.“
Ich trinke meine Milch, aber ich würde gerne mehr wissen: Hättet ihr nicht warten können und du hättest dein Abitur noch gemacht? Aber Omas Lippen, zu zwei schmalen Strichen gepresst, verbieten es mir.
Oma stellt die Butter auf den Tisch. Daneben das Nutellaglas. „Das mögt ihr Kinder heutzutage doch.“
Ich schiebe mein Nutellabrot von der linken Backe in die rechte. Ich trinke einen Schluck Milch. „Heute Nacht. Da war was. Ein Ton. Das war ganz hoch und laut.“
Oma lacht.
„Das war der Kühlschrank, Dummchen! Weißt du gar nichts?“
„Wieso macht der das?“
„Der macht immer so einen Lärm. Sonst kühlt er nicht die Milch und auch nicht das Eis, das du doch so gern zum Nachtisch naschst, nicht wahr? Aber jetzt iss auf. Dann gehen wir raus. Ist schon spät. Die Sonne scheint.“
Wenn ich bei meiner Oma, die alle Meli nennen, obwohl sie Hermine heißt, bin, gehen wir immer morgens spazieren, einmal um den Teich und wieder zurück, und wenn wir heimkommen, schickt sie mich noch auf den Spielplatz, der vor den großen Fünfgeschossern liegt, quer über die Straße, damit sie das Mittagessen richten kann. „Denn da brauch ich keine Kinderfinger dazwischen, da störst du nur dabei.“
Wenn Oma das Mittagessen fertig hat, klappt im vierten Stock das Fenster auf. Oma beugt sich über die Weihnachtssterne und die Glaskugel mit den zierlichen Fahnen aus schwarzem und weißem Metall, die sich drehen, wenn die Sonne darauf scheint, immer im Kreis. Sie ruft: „Komm, das Essen ist fertig!“
Wahrscheinlich habe ich sie aber gar nicht rufen gehört, denke ich heute, denn meine Ohren waren damals schon schlecht, wahrscheinlicher ist, dass ich sie sah. Ich behielt das Fenster fest im Blick, vierter Stock, das dritte von links, ob ich auf der Schaukel saß oder auf der Rutsche oder im Sand.
„Geh, wasch dir die Hände“, sagt Oma, als ich in die Wohnung komme. „Im Sand wimmelt es vor Keimen.“
Ich geh ins fensterlose Bad in der Mitte der Wohnung und wasche mir die Hände.
Das Wasser rauscht.
Ich nehme viel Seife. Dann trockne ich mir die Hände ab.
Oma steht in der Küche mit der Blümchenschürze um die Taille, die heute ein bisschen breiter ist als damals, als sie achtzehnjährig meinen Großvater von der Schulbank weg heiratete.
„Hättet ihr nicht warten können, Oma“, frage ich. „War es denn so eilig?“
Oma versteht nicht.
„Es wär‘ doch nur noch ein Jahr gewesen. Dann hättest du dein Abitur gehabt. Und Opa war doch damals schon ein alter Mann.“
Oma streift die Hände an der Schürze ab. Ihre Hände suchen den Knoten hinter ihrem Rücken.
„Was weißt denn du“, sagt sie.
Ich bin erst acht, aber ich kann schon rechnen.
Mein Onkel wurde 1942 geboren. Ihr erstes Kind. Wann hat Oma geheiratet? Das war im selben Jahr, oder?
„Ihr habt doch nicht …?“
Meine Oma ist eine sanfte Frau. Ich kenne niemanden, der sanfter ist. Aber jetzt wird sie wütend.
„Du sollst nicht“, sagt sie.
Die Kartoffeln werden kalt, die Erbsen, der Braten, den Oma auf ihre unvergleichliche Omaweise zubereitet: angeschmort im Topf, wo das Fleisch vor sich hinsimmert, bis es ganz von allein von der Gabel fällt.
Alles wird kalt, die Mahlzeit bleibt aus. Auch die Nachspeise, die sie mir versprochen hat, bekomme ich nicht, das Eis, das der Kühlschrank kühlt, obwohl er eigens dafür in den Nächten pfeift.
Viele Jahre später, mein dritter Sohn war gerade geboren, stürzte meine Oma in jenem Flur, durch den der Kühlschrank sein nächtliches Pfeifen schickte. Sie lag lange dort, ehe meine Mutter sie fand. Danach war sie ein Pflegefall. Sie sprach nicht mehr. Nur ein Finger blieb ihr zum Schreiben. Man musste sie füttern.
„Jedes Tier hat es besser“, tippte sie einmal in den Computer, der ihr beim Reden half. „Lasst mich endlich sterben!“
Meine Mutter holte sie zu sich nach Hause.
Wo sie dreißig Tage später starb.
Und heute wieder viele Jahre später – seitdem habe ich vier Söhne geboren und einen Mann verloren – stehe ich in meiner Wohnung und denke an den Kühlschrank, der damals pfiff und immer noch pfeift, in meinem Ohr, und schreibe einen Text, an dem nichts stimmt. Denn das Gespräch zwischen mir und meiner Oma hat es nie gegeben, einzig in den Wörtern gewann es Gestalt – als Ausdruck meiner profunden Sehnsucht, die Kluft zu überwinden und Nähe herzustellen von Du zu Du, von ihr zu mir. Ist es darum gelogen oder falsch?
Als ich einjährig, noch bevor ich sprechen lernte, auf der Quarantänestation eines Krankenhauses mit dem Leben rang (oder war es der Tod, mit dem ich kämpfte?), bin ich aus der Welt gefallen, und wie damals im Gitterbett erhalten die Dinge erst ihren Sinn, wenn ich sie benenne. Als meine Oma ein letztes Mal sprach, obgleich es ein zitterndes Schreiben mit nur einem Finger war, zielte ihr Verlangen in eine andere Richtung: Die Zumutungen des Lebens hielten den Erfordernissen des Sterbens nicht stand, sie wollte sterben. Aber auch das mag nicht stimmen, weil ich es mir zusammenreime aus Wunsch und Wirklichkeit. Die Wörter finden die Dinge nicht.
* Nachtrag zum Schiffsymbol: 1946, nachdem der Krieg vorbei war, mussten alle Deutschen China verlassen. Meine Oma fuhr mit ihrer vierköpfigen Familie – meine Mutter war gerade zwei Jahre alt – auf einem US-amerikanischen Truppentransporter vier Wochen über den indischen Ozean durch den Suezkanal bis nach Bremerhaven, von wo aus sie in Viehwaggons nach Ludwigsburg gebracht wurden, da die Stadt unzerstört war und mit ihren zahlreichen Kasernen Platz für viele Menschen bot. Oma blieb. Und ich, die ich vierundzwanzig Jahre später in Ludwigsburg geboren worden bin, lebe heute nach Irrfahrten in Im- und Ausland wieder dort.
Dagmar Petrick wurde 1970 in Ludwigsburg geboren. Kaum hatte sie das Abitur in der Tasche, zog es sie jedoch fort von Trollinger und Maultaschen nach Nordirland, wo sie Deutsch an einem protestantischen Mädchengymnasium unterrichtete, in ihrer Freizeit am liebsten aber durch die Straßen von Belfast zog. Folgerichtig beschloss sie, Journalistin zu werden. Nach einem Studium der Anglistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und ev. Theologie in Marburg und Bochum und etliche Essays über Filme später, wandte sie sich zunehmend eigenen Geschichten zu – und ist seitdem dabei geblieben. Nachdem sie längere Zeit in England und den USA dichtete, schreibt, denkt und lebt sie inzwischen wieder im Schwabenländle, bisweilen noch umgeben von ihren vier Söhnen und einem (männlichen) Hund. aus: https://www.lovelybooks.de/autor/Dagmar-Petrick/
Mehr über Dagmar Petrick unter https://dagmarpetrick.de/